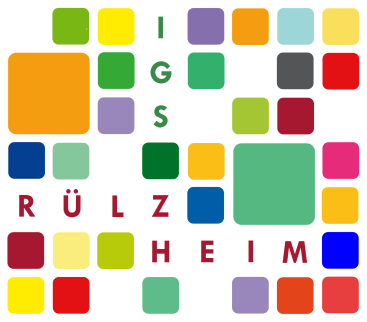Schule ohne Rassismus Integrierte Gesamtschule Rülzheim
Das IGS Rülzheim hat über eine aktive Schüler*innen-AG seine Aktivitäten im Rahmen von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wieder aufgenommen.
Das neue Konzept beinhaltet ein festes Programm, das jährlich für jeden Jahrgang Workshops und Veranstaltungen zu festgelegten Schwerpunkten im Bereich Antidiskriminierung durchführt. So soll garantiert werden, dass sich alle Schüler*innen einmal in ihrer Schullaufbahn mit diesen Themen beschäftigen.
Das Wichtigste in Kürze
- Schulform:
- Gesamtschule
- Handlungsfelder:
- Diskriminierung als Thema in AGs, Diskriminierung als Thema im Unterricht
- Bundesland:
- Rheinland-Pfalz
- Diskriminierungskategorie:
- alle Diskriminierungskategorien
- Durchführung:
- seit 2022
Kontakt
IGS Rülzheim, Schulstraße 17, 76761 Rülzheim
E-Mail:
sekretariat@igs-ruelzheim.de
Telefon:
07272 92974-0
Rahel Rohrmoser, Lehrerin
E-Mail:
rahel.rohrmoser@igsr.bildung-rp.de
Carsten Metz
E-Mail:
carsten.metz@igsr.bildung-rp.de
Daniela Johannes
E-Mail:
daniela.johannes@igsr.bildung-rp.de
Durchführende Organisation
Die IGS Rülzheim ist eine integrierte Gesamtschule mit einem großen, eher ländlichen Einzugsgebiet, in der alle Abschlüsse erworben werden können. Bis zur 10. Klasse ist sie vierzügig. Als Schwerpunktschule ermöglicht sie Kindern mit einem besonderen Förderbedarf die Teilnahme am Regelunterricht. Der integrative Unterricht wird durch Förderlehrkräfte und Schulassistenz unterstützt. Auch für Kinder mit einer Migrationsbiografie mit besonderem Förderbedarf gibt es zusätzliche Assistenz.
Am Reflexionsgespräch Beteiligte
Zwei Lehrer*innen, die an der Konzepterstellung „Schule ohne Rassismus“ mitgearbeitet haben
Ausgangslage und Motivation
Bei einem Schulumbau wurde die schon angestaubte Plakette von „Schule ohne Rassismus“ im Keller gefunden. Auf Initiative der Schulleitung haben daraufhin zwei Lehrkräfte ein Konzept für eine Reaktivierung des Programms entwickelt.
Ziel war es, als Schule allen Diskriminierungsformen entgegenzuwirken. Gleichzeitig sollen die Schüler*innen zu selbstständigem Handeln und Denken angeregt werden, um sich in der Gesellschaft behaupten und Diskriminierung bekämpfen zu können. Im Fokus des Programms stehen daher die Schüler*innen.
Maßnahmenbeschreibung
Die AG
Auf einen Aufruf der beiden beauftragten Lehrkräfte meldeten sich viele Schüler*innen. 30 Schüler*innen aus allen Klassenstufen treffen sich nun einmal in der Woche in der Mittagspause zu einer AG „Schule ohne Rassismus“. In der AG arbeiten Schüler*innen gemeinsam mit den Lehrkräften. Wichtig ist der offene Austausch über Themen wie multikulturelle Schule, Religion oder queere Community.
Viele Impulse für kleinere und größere Aktionen kommen von den Schüler*innen. So soll es im neuen Schuljahr eine größere Aktion mit der erstmaligen Verlegung von Stolpersteinen in Rülzheim geben.
Ein klassenübergreifendes Schulprogramm
Der Kern des Programms ist ein Konzept, das jährlich für jeden Jahrgang Workshops zu verschiedenen Diskriminierungsformen durchführt.
Im aktuellen Programm sind folgende festen Themen vorgesehen:
- Jahrgang 5/6: Cybermobbing
- Jahrgang 7/8: Sprachsensibilisierung in den Bereichen LGBTQIA* und Rassismus
- Jahrgang 9/10: Antisemitismus und Rassismus
- Jahrgang 11/12: Vertiefung verschiedener Bereiche und Benennung von Strukturen
Die Idee hinter dem Programm ist, dass alle Schüler*innen in ihrer Schullaufbahn zumindest einmal mit diesen Themen konfrontiert sind.
Die Planung der Workshops findet durch die Lehrer*innen statt, die AG-Mitglieder sind an der Umsetzung beteiligt. Die Workshops werden von externen Trainer*innen zum Teil mit Kooperationspartner*innen durchgeführt. Manche, wie die Cybermobbing-Workshops, finden im Umfang von zwei bis vier Schulstunden im Klassenverbund statt. Andere Themen werden aus Kapazitätsgründen auch in größeren Veranstaltungen mit ganzen Jahrgangsstufen behandelt. So präsentierte in der 9. und 10. Jahrgangsstufe Mo Asumang ihren autobiografischen Film.
Verstetigung und Verankerung
Auch wenn es sich um ein noch sehr junges Projekt handelt, sind die „Schule ohne Rassismus AG“ sowie das klassenübergreifende Workshopangebot als langfristiges Konzept an der Schule angelegt. Das Kollegium unterstützt aktiv die Arbeit der AG. Für die beiden Lehrkräfte gibt es für diese Aufgabe eine Stunde Deputatsermäßigung.
Die kontinuierliche Kooperation mit dem Courage-Netzwerk, externen Partner*innen aus der Region sowie der Kommune ist fest verankert.
Positive Effekte aus Sicht der Akteur*innen
Das Projekt ist noch zu neu, um schon langfristige Effekte beschreiben zu können. Aber der erste Eindruck ist, dass es in der Schule zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit den behandelten Fragestellungen kommt. Die Schüler*innen, die an der AG teilnehmen, sind durch die Arbeit bestärkt, sich in der Klasse zu positionieren.
Ob dies aber bereits dazu führt, dass zum Beispiel diskriminierende Sprüche auf dem Schulhof weniger geworden sind, ist nicht einzuschätzen. Um die Schulkultur tiefer zu verändern, braucht es noch mehr Zeit.
Gelingensfaktoren, Herausforderungen und Grenzen
Gelingensfaktoren
Haltung: Es gibt keine Schule ohne Diskriminierung
Auch wenn der Name der AG etwas anderes nahelegt, so ist die Überzeugung der beteiligten Akteur*innen, dass es keine Schule ohne Rassismus, keine Schule ohne Diskriminierung gibt, sondern Diskriminierung in allen Institutionen dieser Gesellschaft immer eine Rolle spielt. Für diese Haltung gibt es auch eine grundsätzliche Unterstützung aus dem Kollegium, des Schulelternbeirats und der Schüler*innenvertretung der Schule.
Engagement der AG
Es ist mit der AG gelungen, den Schüler*innen einen Raum zu geben, sich als Multiplikator*innen für das Thema zu engagieren. Es war eine bewusste Entscheidung, die AG als freiwillige AG zu planen. Die Schüler*innen besuchen die AG in ihrer Mittagspause, ohne dafür AG-Punkte zu bekommen.
Gelebte Erfahrungen im Umgang mit Heterogenität
In der Schule gibt es durch die vielfältige Schüler*innenschaft bereits eine Alltagskultur, die durch den selbstverständlichen und gelebten Umgang mit Heterogenität geprägt ist. So ist die Inklusion von autistischen Schüler*innen in der Oberstufe ein tägliches Lernfeld. Die hier gelernte Awareness (Bewusstsein) wirkt sich auch auf andere Diversitätsdimensionen aus.
Expert*innen in eigener Sache
Den Schüler*innen in der AG war es wichtig, dass Expert*innen in eigener Sache an die Schule kommen. Dies war auch ein Grund, Mo Asumang mit ihrem Film „Die Arier“ einzuladen. Diese Veranstaltung war für die Schüler*innen und Lehrer*innen sehr motivierend und hat viel Reflexion und Nachdenken ausgelöst.
Finanzierung durch Vernetzungsarbeit
Das klassenübergreifende Schulprogramm hat aufgrund der extern durchgeführten Workshops 9.500 Euro gekostet. Die Schule selbst hat dafür kein Budget. Die Akquise dieser Mittel war ein wesentlicher Teil der Arbeit der beiden beauftragten Lehrkräfte. Sie waren in einem regelmäßigen Kontakt mit dem Bürgermeister, aber auch mit Stiftungen und der Regional- und Landeskoordination des Netzwerks für Demokratie und Courage (NDC).
Herausforderungen und Grenzen
Umgang mit konkreten Vorfällen und Beschwerden
Wenn Diskriminierung zum Thema wird, gibt es oft Gegenreaktionen und es wird sichtbar, dass es keine Routinen und Verfahren im Umgang mit konkreten Vorfällen gibt. Dies hat sich an verschiedenen Stellen des Prozesses als herausfordernd dargestellt, so zum Beispiel, als als Reaktion auf die AG-Arbeit die LGBTQIA*-Flagge anonym abgerissen wurde. Oder als eine Lehrkraft mitbekommen hat, dass ein antisemitisches Schimpfwort im Klassenzimmer benutzt wurde. In diesem Fall hat die Lehrkraft sehr gezielt mit einer Einheit im Fach Geschichte darauf reagiert. Doch bleiben hier Fragen offen: Hängt es von der Haltung und Kompetenz der einzelnen Lehrkraft ab, wie in einem solchen Fall reagiert wird, oder gibt es dazu eine gemeinsame Haltung der Schule? Braucht es hier eine klare Ansprechperson, an die sich die Schüler*innen hätten wenden können? Sind die Vertrauenslehrer*innen darauf vorbereitet, damit umzugehen?
Gerade wenn über die Arbeit einer aktiven AG Diskriminierung an der Schule zum Thema wird, braucht es auch ein Konzept für den Umgang mit Beschwerden und einen Leitfaden für den Umgang in konkreten Situationen.
Heterogenität der AG
Die AG ist für alle Altersstufen ausgeschrieben und wird von Schüler*innen zwischen 10 und 19 Jahren besucht. Dieser Altersunterschied ist immer wieder eine Herausforderung, da die Art und Weise des Zugangs zum Thema und auch Aktionsformen oft nicht für alle passen. Wünschenswert wäre, wenn für verschiedene Altersstufen unterschiedliche Angebote gemacht werden könnten.
Fehlende Zeitressourcen
Dass die Zeitressourcen der Lehrkräfte knapp sind, ist eine der entscheidenden Grenzen für diese Arbeit. Für die Umsetzung eines so ambitionierten Programms braucht es engagierte Lehrer*innen, die bereit sind, über ihr Deputat hinaus Energie in diese Arbeit zu stecken.
So bleibt auch manches auf der Strecke, was dem Projekt noch zu einer nachhaltigeren Wirkung verhelfen würde:
- eine gute inhaltliche Vorbereitung der AG-Sitzungen und auch der Workshops, zusätzliche Zeit, um in den Klassen zu arbeiten, die Qualifizierung und ständige Einbeziehung der Kolleg*innen
- die Entwicklung von Konzepten, um das Thema Diskriminierung als Querschnittsthema in den einzelnen Schulfächern einzubinden
- der Plan, das Programm auszubauen und jedes Jahr einen anderen Themenschwerpunkt für alle Klassenstufen anzubieten
Eine gute Verbindung der Workshops mit dem Regelunterricht hängt auch von der Kompetenz und dem Engagement der Lehrpersonen ab. Und auch wenn es hier eine grundsätzliche Offenheit gibt, so gab es doch bisher noch keine tiefer gehende Reflexion zum Thema Antidiskriminierung im Lehrer*innenkollegium.
Tipps für die Übertragung
Für die beteiligten Lehrkräfte war es der entscheidende Schritt, das Projekt nach dem Bottom-up-Prinzip aufzubauen, also die Schüler*innen mitgestalten zu lassen und sie als Multiplikator*innen zu sehen.
Gleichzeitig braucht es die aktive Unterstützung der Schulleitung. Dies bezieht sich sowohl auf den organisatorischen Rahmen als auch auf eine inhaltliche Unterstützung.