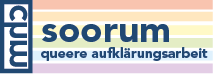soorum Aufklärungsprojekt Magnus-Hirschfeld-Centrum Hamburg
soorum ist ein queeres Schulaufklärungsprojekt, das vorwiegend mit Schüler*innen ab der 9. Klassenstufe arbeitet. Ehrenamtliche Teamer*innen bieten nach dem Peer-to-Peer-Konzept Workshops zu den Themen geschlechtliche und sexuelle Diversität für Schulklassen an. Diese finden in einer queeren Beratungs- und Jugendeinrichtung, also in Räumlichkeiten außerhalb der Schule, statt.
Das Wichtigste in Kürze
- Schulform:
- Berufsschule, Förderschule, Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, Gymnasium, Oberschule, Sekundarstufe
- Handlungsfelder:
- Workshopangebote an einem außerschulischen Lernort, Empowermentorientierte Angebote an der Schule, Peer-to-Peer-Ansatz, Antidiskriminierungsarbeit
- Angaben zum Träger des Praxisbeispiels:
- soorum ist ein Projekt des Magnus-Hirschfeld-Centrums in Hamburg. Es erreicht alle Schulformen außer der Grundschule.
- Bundesland:
- Hamburg
- Diskriminierungskategorie:
- Sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und alle weiteren queeren Menschen
- Durchführung:
- seit 1994
Kontakt
Allgemein E-Mail: soorum@mhc-hamburg.de Telefon: 040 69454841 Website: Magnus-Hirschfeld-Centrum Hamburg
Durchführende Organisation
Das Magnus-Hirschfeld-Centrum ist ein Verein, der sich für Chancengleichheit und die positive Wertschätzung einer heterogenen Gesellschaft einsetzt. Es beherbergt vielfältige Angebote für schwule, lesbische, bisexuelle und trans* Personen aus unterschiedlichsten Bevölkerungskreisen in vielen Gruppen und Selbsthilfegruppen.
Am Reflexionsgespräch Beteiligte
Am Reflexionsgespräch nahm eine der hauptamtlichen Koordinator*innen von soorum teil.
Ausgangslage und Motivation
In der Jugend spielen Themen wie sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität eine bedeutende Rolle. Viele Schulen haben noch keine adäquaten Angebote in diesem Bereich, manche Lehrkräfte fühlen sich mit diesen Fragen überfordert. An anderen Schulen ist das Themenfeld bereits fest verankert und gut aufbereitet. In beiden Fällen setzt soorum mit seinen Workshops an. Über die Arbeit mit Schulklassen sollen Vorurteile abgebaut und das Reden über queere Themen normalisiert werden.
Maßnahmenbeschreibung
Das Team
Das Projekt wird von einem hauptamtlichen Leitungsteam organisiert und von 30 ehrenamtlichen Teamer*innen durchgeführt. Die Teamer*innen sind zwischen 15 und 26 Jahre alt. Manche von ihnen arbeiten über viele Jahre bei soorum als erfahrene Betreuer*innen.
Die Zielgruppe
soorum bietet Workshops für Schulklassen ab der 9. Klasse an. In der Regel kommen Lehrkräfte auf das Projekt zu, weil sie einen Bedarf für ihre Klasse sehen, in einem guten Rahmen die Themen„Sexuelle Orientierung“ und/oder Geschlechtsidentität zu bearbeiten.
Die Workshops
Die dreistündigen Workshops haben einen festen Rahmen: Nach einem Start mit ersten Begriffsklärungen zeigen die Teamer*innen das Magnus-Hirschfeld-Centrum. Danach teilt sich die Klasse ohne die Lehrer*innen in zwei bis drei Gruppen mit je zwei Teamer*innen auf. Nach einer Einstiegsübung sammeln die Schüler*innen alle Fragen, die sie den Peer-Teamer*innen stellen wollen. Die Teamer*innen verbinden in ihren Antworten eigene Lebenserfahrungen, auch Erfahrungen im Umgang mit Diskriminierung mit inhaltlicher Aufklärung. Nach einer Pause wechseln die Gruppen und können dann auch die anderen Teamer*innen befragen. Am Ende des Workshops kommen alle zu einer kurzen Abschlussrunde – dann auch wieder mit den Lehrer*innen – zusammen.
Die Themen
Bereits im Vorfeld der Workshops bekommen die Lehrer*innen einen Fragenkatalog, in dem sie die jeweiligen Bedarfe und die Situation in der Klasse beschreiben können. Die Teamer*innen nehmen die vorgeschlagenen Themen auf, stimmen sie aber nochmals mit den Schüler*innen vor Ort ab. Der Fokus liegt aktuell auf Fragen zum Thema „Geschlechtliche Identität“. Dabei geht es immer auch um Erfahrungen von Diskriminierung dieser Gruppe.
Gibt es geoutete queere Schüler*innen in den Klassen, werden deren Bedarfe besonders berücksichtigt.
Verstetigung und Verankerung
Die Arbeit von soorum ist im Magnus-Hirschfeld-Centrum fest etabliert. Die Finanzierung ist verstetigt und läuft über zwei Behörden. Sie muss jährlich neu beantragt werden, wodurch sich diese Situation in Zukunft ändern könnte.
Positive Effekte aus Sicht der Akteur*innen
Überhaupt über das Thema sprechen
Die Workshops regen unmittelbar zu Diskussionen innerhalb der Klassengemeinschaft, aber auch des Freund*innenkreises der Schüler*innen an. Die Schüler*innen kommen – zum Teil erstmals – in Kontakt mit Begrifflichkeiten geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Die Jugendlichen machen die Erfahrung, dass es möglich ist, offen und respektvoll über diese Themen zu sprechen.
Stärkung von Schüler*innen
Der Besuch eines Workshops kann für alle Schüler*innen eine stärkende Erfahrung sein. Vor allem geoutete queere Schüler*innen, die es in den Schulklassen zunehmend gibt, erleben die Peer-Trainer*innen oft als Vorbilder. Immer wieder kommt es infolge der Workshops auch zur Gründung von queeren Schüler*innen-AGs an den Schulen.
Stärkung der Peer-Trainer*innen
Viele Peer-Teamer*innen erleben die Arbeit bei soorum empowernd. Sie lernen über ihre Erfahrung zu sprechen, sind im Austausch mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, und sie erleben, dass sie mit ihrer Expertise etwas für andere tun können.
Gelingensfaktoren, Herausforderungen und Grenzen
Gelingensfaktoren
Der Peer-to-Peer-Ansatz
Nahezu alle Teamer*innen verstehen sich selbst als queer. Sie arbeiten in den Workshops als „Expert*innen in eigener Sache“, was bedeutet, dass sie auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können. Zusätzlich besuchen sie regelmäßig Fortbildungen und bereiten die Termine vor und nach, sodass sie die Erfahrungen auch einordnen und pädagogisch vermitteln können.
In den Workshops ermöglicht dies den Schüler*innen einen anderen Zugang, als ihn der Unterricht bieten könnte. Die Expertise der Teamer*innen wirkt authentisch und bleibt eine individuelle Erfahrung. Es wird also kein Wissen über die „queeren“ Personen vermittelt, sondern queere Personen werden in ihrer individuellen Persönlichkeit sichtbar.
Der Ort
Die Workshops finden in den Räumen des Magnus-Hirschfeld-Centrums statt. Es ist eine bewusste Entscheidung, für diese Arbeit einen außerschulischen Lernort zu wählen. Daneben hat dies den Effekt, dass Schüler*innen das Magnus-Hirschfeld-Centrum kennenlernen und so einen niedrigschwelligen Zugang zu unterstützenden Angeboten erhalten.
Die Qualifizierung und Begleitung der Teamer*innen
Alle Peer-Teamer*innen durchlaufen Fortbildungen und treffen sich regelmäßig mit der Projektleitung zum Austausch. Jeder Schultermin wird vor- und nachbesprochen. Das hauptamtliche Team erhält zusätzlich eine externe Supervision. Daneben gibt es ein monatliches Treffen sowie weitere Angebote wie Filmabende. Das Team wird so zu einem „Empowermentraum“ für die Teamer*innen, in dem sie sich in ihrer eigenen Identität stärken.
Der methodische Ansatz
Die Workshops haben kein Curriculum, es definiert niemand vorher, was andere lernen sollen. Die Themen ergeben sich aus den Fragen der Schüler*innen. Es gibt vereinbarte Regeln, die den Rahmen für die offenen Gesprächsrunden festlegen. Auch wird deutlich gemacht, dass alles, was das Team in den Kleingruppen erzählt, selbstverständlich weitergesagt werden kann. Der Ausschluss der Lehrkräfte aus den Kleingruppen soll den Schüler*innen einen möglichst vertrauten Rahmen geben.
Dabei gibt es keine guten und schlechten Fragen. Wenn Fragen dabei sind, auf die ein*e Teamer*in nicht antworten möchte, wird das in Ruhe besprochen und gegebenenfalls erklärt, warum keine Antwort gegeben wird.
Aufseiten der Schüler*innen ist die aktive Mitwirkung zu jedem Zeitpunkt freiwillig.
Herausforderungen und Grenzen
Grenzen der Arbeit mit ehrenamtlichen Teamer*innen
Was auf der einen Seite eine große Ressource für die Arbeit von soorum ist, ist gleichzeitig eine Herausforderung: Die Teamer*innen sind keine pädagogischen Fachkräfte, sondern junge Ehrenamtliche. Die autobiografische Arbeit kann manche an ihre emotionalen Grenzen bringen. Dies hat auch schon dazu geführt, dass Teamer*innen ihre Arbeit beendet haben. In der Zusammensetzung der jeweiligen Teams achtet die Projektleitung darauf, dass immer eine Person dabei ist, die schon längere Erfahrung mitbringt.
Jenseits der Kategorien der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt ist das Team weniger divers. Hier versucht das Projekt gegenzusteuern, was allerdings nicht so leicht ist. Da Ehrenamt, gerade vormittags unter der Woche, durchaus auch ein Privileg ist, bietet soorum für Menschen, die sich ein solches Ehrenamt nicht leisten können, Übungsleiterpauschalen an, um einen kleinen finanziellen „Ausgleich“ zu bieten.
Umgang mit Queerfeindlichkeit
Insgesamt gab es bisher eher wenige offene Anfeindungen oder Hatespeech. Aber es gibt Vorfälle von Schüler*innen mit einer feindlichen Einstellung. Bei grenzüberschreitendem Verhalten ist es möglich, sie aus dem Workshop zu nehmen oder auch den Workshop abzubrechen – das ist bisher aber nur sehr selten vorgekommen. Immer wieder entziehen sich Schüler*innen dem Workshop und melden sich krank, weil sie selbst oder ihre Eltern eine Teilnahme nicht wollen. Da das Konzept von soorum auf Freiwilligkeit beruht, hat es auch nicht den Anspruch, Schüler*innen mit explizit queerfeindlichen Einstellungen zu einer anderen Einstellung zu zwingen. Vielmehr ist die Hoffnung, dass alle Schüler*innen von dem Workshop profitieren und zum Reflektieren eingeladen werden.
Über die Workshops ist keine dauerhafte Begleitung möglich
Die soorum-Workshops verstehen sich als ein Baustein in der schulischen Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld. Sie sind kein Ersatz für weitere Maßnahmen an der Schule zur Bearbeitung des Themas. Dies wird den Schulen auch so kommuniziert.
Zur Vor- und Nachbereitung können Materialien verschickt werden, aber das Projekt hat keinen Einfluss darauf, inwieweit diese genutzt oder die Themen ansonsten vor- und nachbereitet werden.
Die Grenze der Ressourcen
Die Nachfrage nach den Workshops ist seit einigen Jahren weit größer als die Anzahl, die vom Team umgesetzt werden kann. Damit sind die Möglichkeiten für ergänzende Angebote ebenfalls begrenzt. So kann soorum weder Schüler*innen, die sich mit Diskriminierungserfahrungen an die Teamer*innen wenden, noch queere Schüler*innen-AGs, die aus den Workshops entstehen, angemessen weiter begleiten. Sie können hier nur an andere Unterstützungsangebote verweisen.
Tipps für die Übertragung
Über das Workshopangebot an einem außerschulischen Lernort kann eine besondere Lernkultur geschaffen werden. Für die Schüler*innen wird es möglich, außerhalb von Bewertungskontexten ihre Fragen zu stellen. Sie machen die Erfahrung, dass eine direkte und trotzdem achtsame Kommunikation zu persönlichen und vulnerablen Themen möglich ist.
Es ist gerade bei Peer-to-Peer-Konzepten wichtig, auf die eigenen Grenzen zu achten und ein unterstützendes Netzwerk für die Teamer*innen aufzubauen.